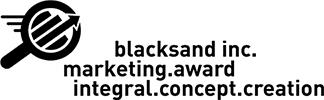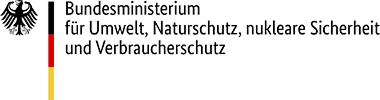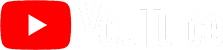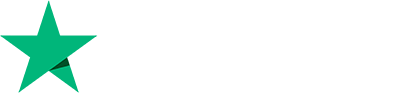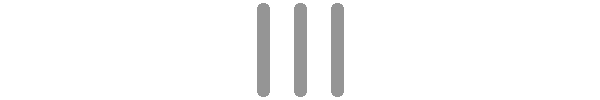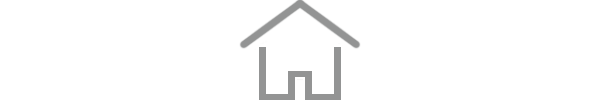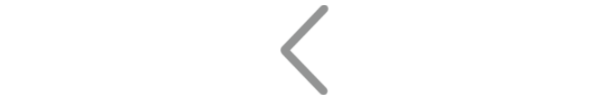Künstler Markus Philipp im Porträt
Markus Philipp begann schon sehr früh, sich für Kunst zu interessieren. Als Teenager entwarf er seine erste eigene Modekollektion und knüpfte die ersten Kontakte in der Kreativszene. 2014 entdeckte eine mit ihm befreundete #Künstlerin durch Zufall einige Zeichnungen von Philipp und ermutigte ihn daraufhin, einen künstlerischen Beruf zu ergreifen. Daraufhin schloss er sich einer Ateliergemeinschaft von neun Künstlern an. Dies wirkte sich sehr positiv auf seinen Output aus, sodass er bereits im Jahr 2015 seine erste Ausstellung in einer Galerie gab. Trotz de Erfolge mit seiner Kunst arbeitete er viele Jahre hauptberuflich als Software-Ingenieur. Erst 2019 fasst er den Entschluss, sich komplett seiner Kunst zu widmen und als freischaffender Künstler tätig zu sein. Sein einzigartiger Stil kommt in seinen expressiven und farbkräftigen Ölbildern voll zur Entfaltung. Sein Oeuvre war bereits in mehreren Ausstellungen in München und Hamburg zu sehen. In folgendem exklusiven Gastbeitrag gibt Ihnen Markus Philipp einen Einblick in sein Schaffen.
Die Ausgangslage
Sehr oft bekomme ich in kunsttheoretischen Diskurs die Frage nach der Verbindung von Form und Funktion gestellt. Eine sehr spannende Frage, auf die wie ich finde, jeder #Künstler seine eigene Antwort finden muss – und das in der Vergangenheit auch vielfach getan hat.
Mein Ziel ist es, mit meiner #Kunst die schier unendliche Wahrheit einer Form zum Ausdruck zu bringen. Das heißt, mit ihrer zunächst einmal rein oberflächlichen Darstellung ihrer ersten Ausdrucksform ist die Form noch lange nicht an ihrem Ende angekommen.
Diese Herausforderungen stellen sich mit jedem Motiv von neuem, für mich ist es aber die Komposition des menschlichen Körpers, dessen Darstellung mir bei der künstlerischen Arbeit am meisten abverlangt. Aber wohlgemerkt möchte ich dem Betrachter meine Sichtweise nicht aufdrängen. Darin besteht sogar ein ganz essenzieller Bestandteil meiner vielschichtigen Maltechnik. Die Kombination von Schärfe und Unschärfe liefert dem Betrachter einen größeren interpretatorischen Spielraum, in dem er sich erst einmal irgendwie zurechtfinden muss. Doch damit leite ich eine Reise ein, auf der sich der Betrachter auf die Suche nach seiner eigenen Wahrheit begibt.
Viele sagen immer, ein Bild sei statisch und ändere sich nicht. Dem halte ich entgegen, dass der Zahn der Zeit sehr wohl an der Erscheinung nagt und damit zwar destruktiv, aber zugleich auch konstruktiv zu Werke geht. Denn wo Ebenen verschwinden, bilden sich fortwährend auch neue, überlagernde Ebenen. Dieser Prozess stellt für mich eine Allegorie auf das menschliche Leben dar: Vergessen ist ein Prozess, bei dem ein Teil unserer inneren Schichten verschwindet. Das Dasein löst sich von uns ab, und wenn wir uns nur an das Erinnern, an das wir uns erinnern möchten, treten trügerische Idealbilder auf den Plan. Diese haben jedoch einen rein destruktiven Charakter, denn auf unsere eigene Identität üben sie einen zerstörerischen Einfluss aus und töten unsere weitere Entwicklung einfach ab.
Eine Konzeptkunst, die sich selbst thematisiert
Meine Arbeiten verstehe ich als Konzeptkunst: Denn in der Auseinandersetzung mit künstlerischen Werken ist der Betrachter quasi ohne Unterlass dazu gezwungen, seine zum Teil althergebrachten Idealvorstellungen mit dem abzugleichen, was er vor sich sieht. Deswegen sagt man ja auch, dass es so viele Interpretationen wie Rezipienten gibt und deswegen gehen die Meinungen über viele, zum Teil auch ganz bedeutende Kunstwerke so stark auseinander. Meine Kunst thematisiert diesen Ablauf, dieses eigentümliche Vexierspiel. Ich zwinge niemanden dazu, die Dinge so zu sehen wie ich, letztendlich möchte ich nur die Tür aufmachen und Alternativen aufzeigen.
Welche Rolle spielt also die Form bei meinem oder bei einem künstlerischen Ausdruck im Allgemeinen? Nun, ich verstehe mich als einen bekennenden Verfechter der „Fusionart“. Dieser Begriff definiert für mich ein Zusammenspiel vielfältiger Techniken, die aber alle eine spezifische Geschichte gemeinsam haben. Diese Geschichte beginnt meist bei einem unmittelbar und unreflektiert aufgenommenen Ausdruck und setzt sich dann über die komplexe Themenerstellung fort. Entweder steht beim Prozess ein bestimmtes Gefühl im Hintergrund oder es werden gesellschaftliche bzw. politische Bezüge angedeutet.
Dabei arbeite ich gerne sowohl im Porträt-Stil als auch figurativ. In jedem Fall aber konkret, also objektbezogen. Manchmal greife ich zwar schon auf einen realen Kontext zurück und versuche dann, ihn mit abstrakten Elementen zu konterkarieren.
Fazit
Markus Philipp hat seinen eigenen Stil gefunden, der vom Betrachter Mut verlangt, sich auf seine spezifische Bildsprache einzulassen. Doch einmal eingetaucht, erwarten ihn spannende Erlebnisse, die die althergebrachten Sehgewohnheiten infrage stellen.
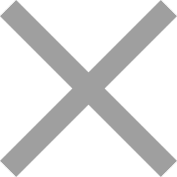








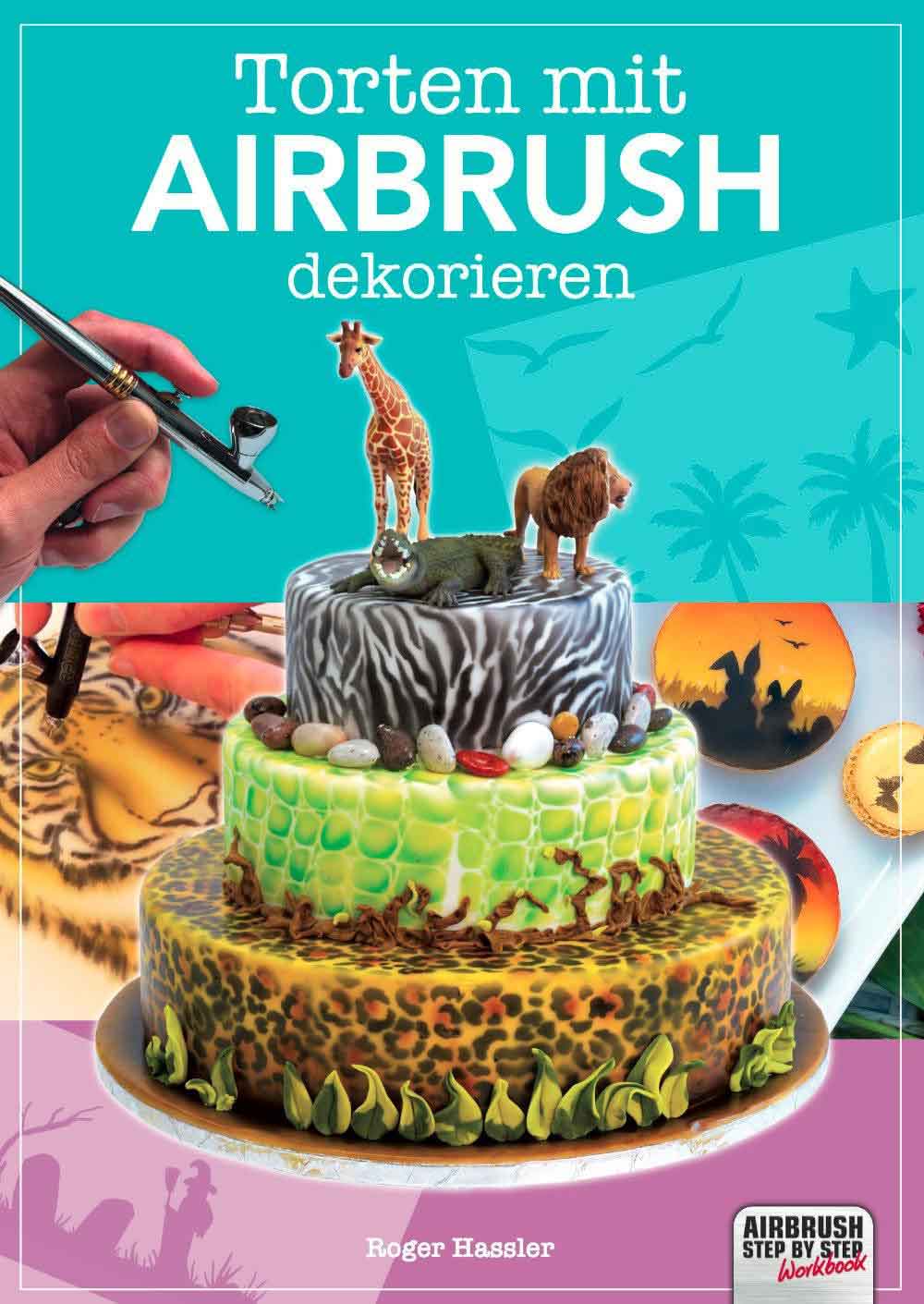


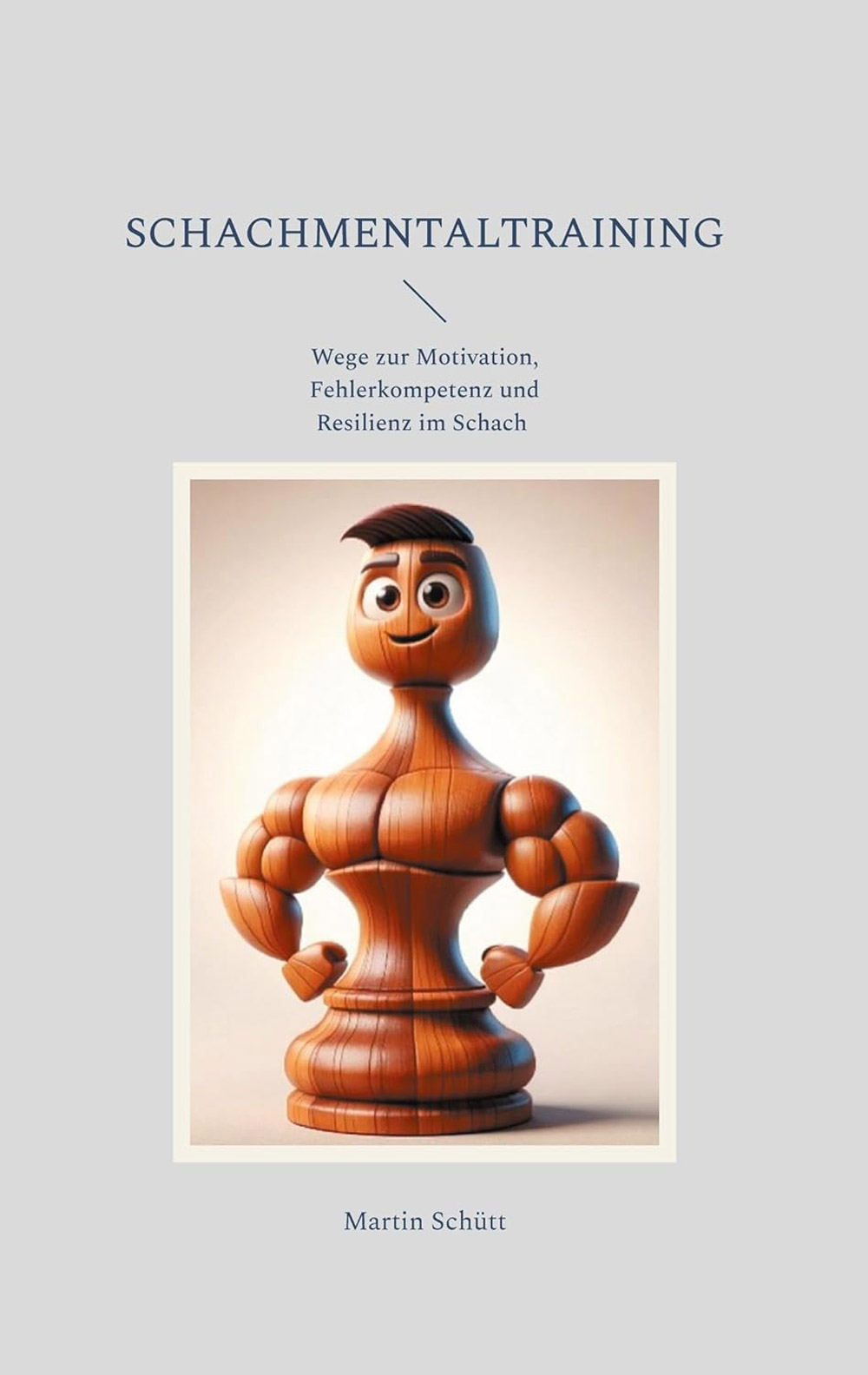

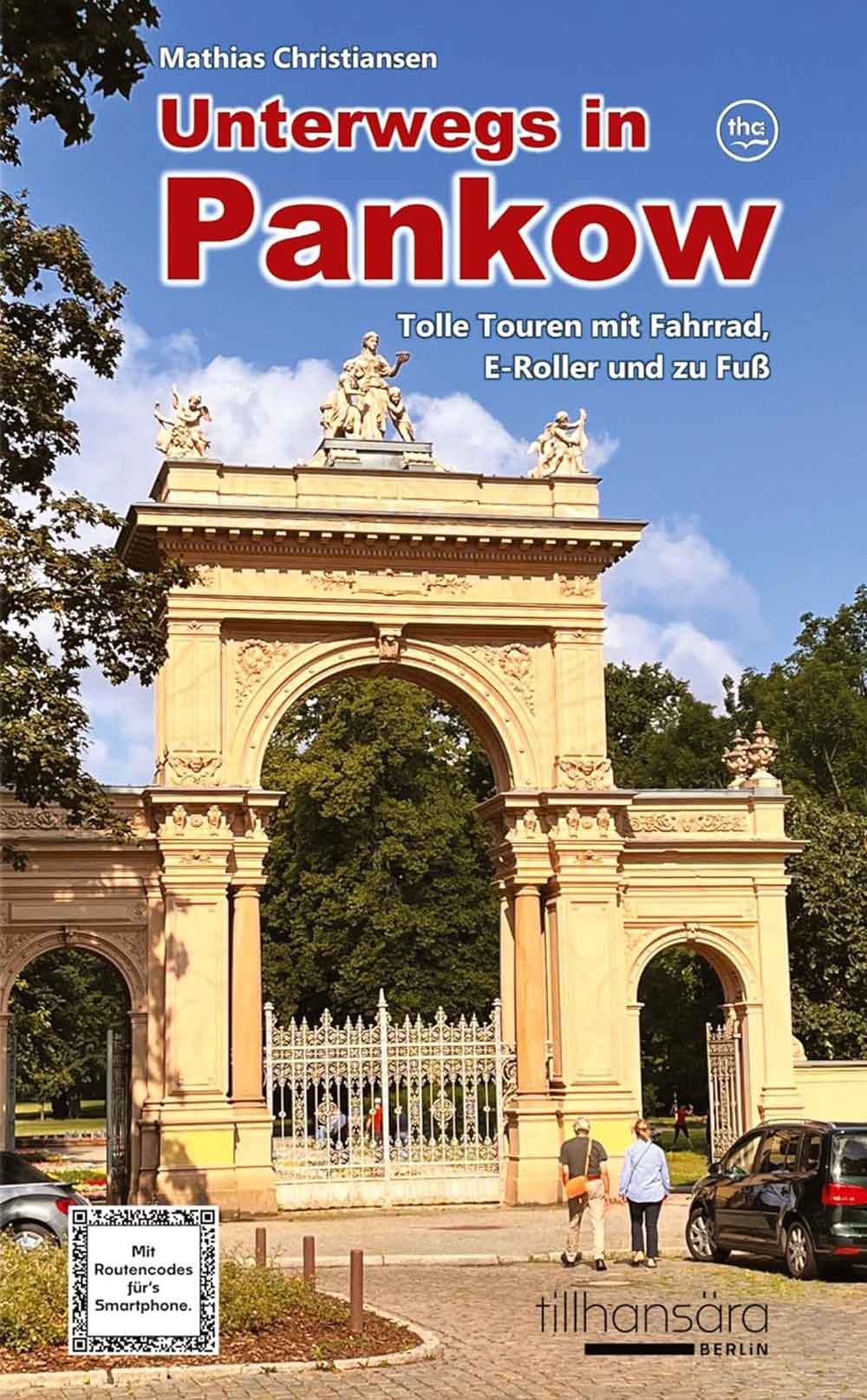





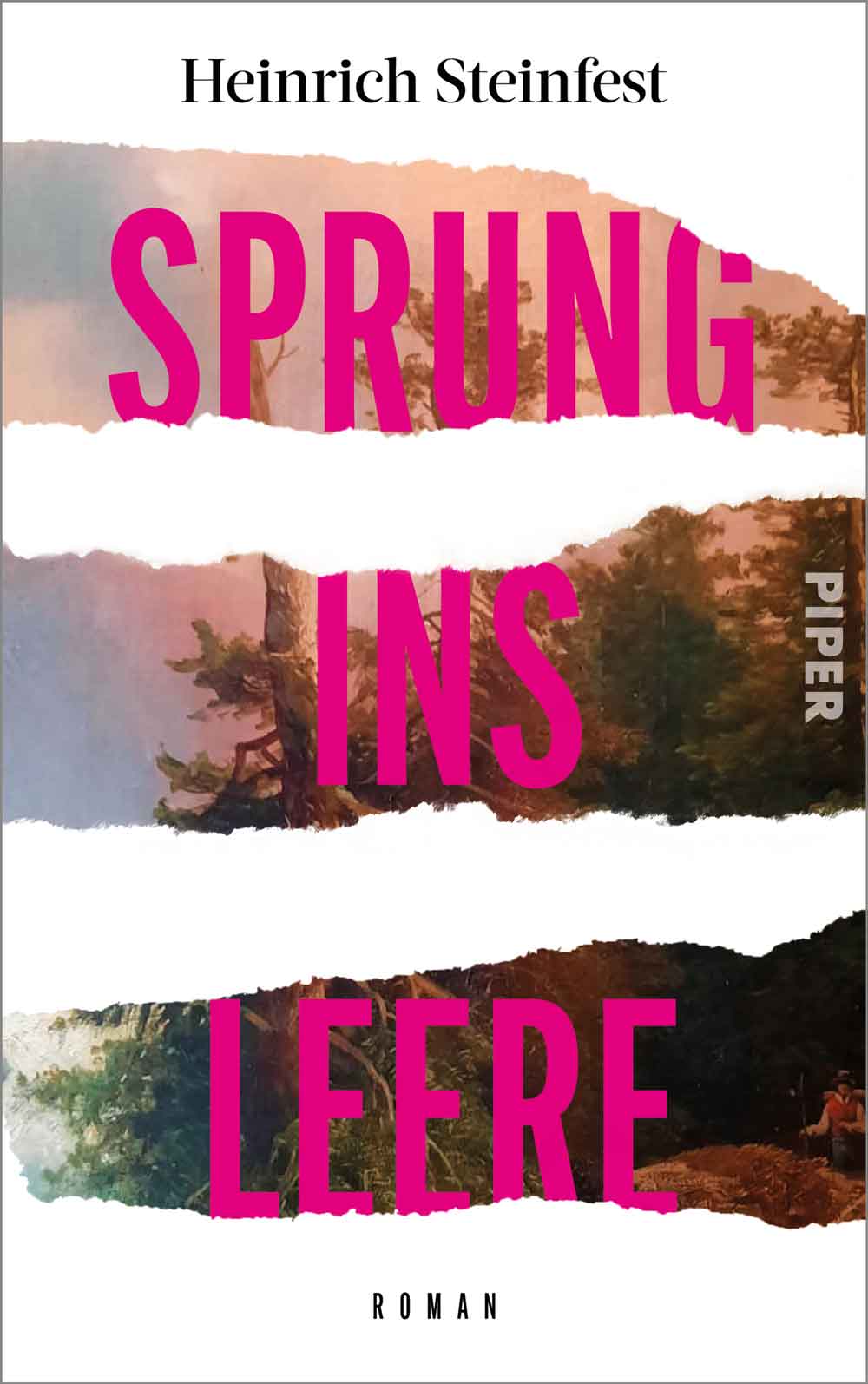

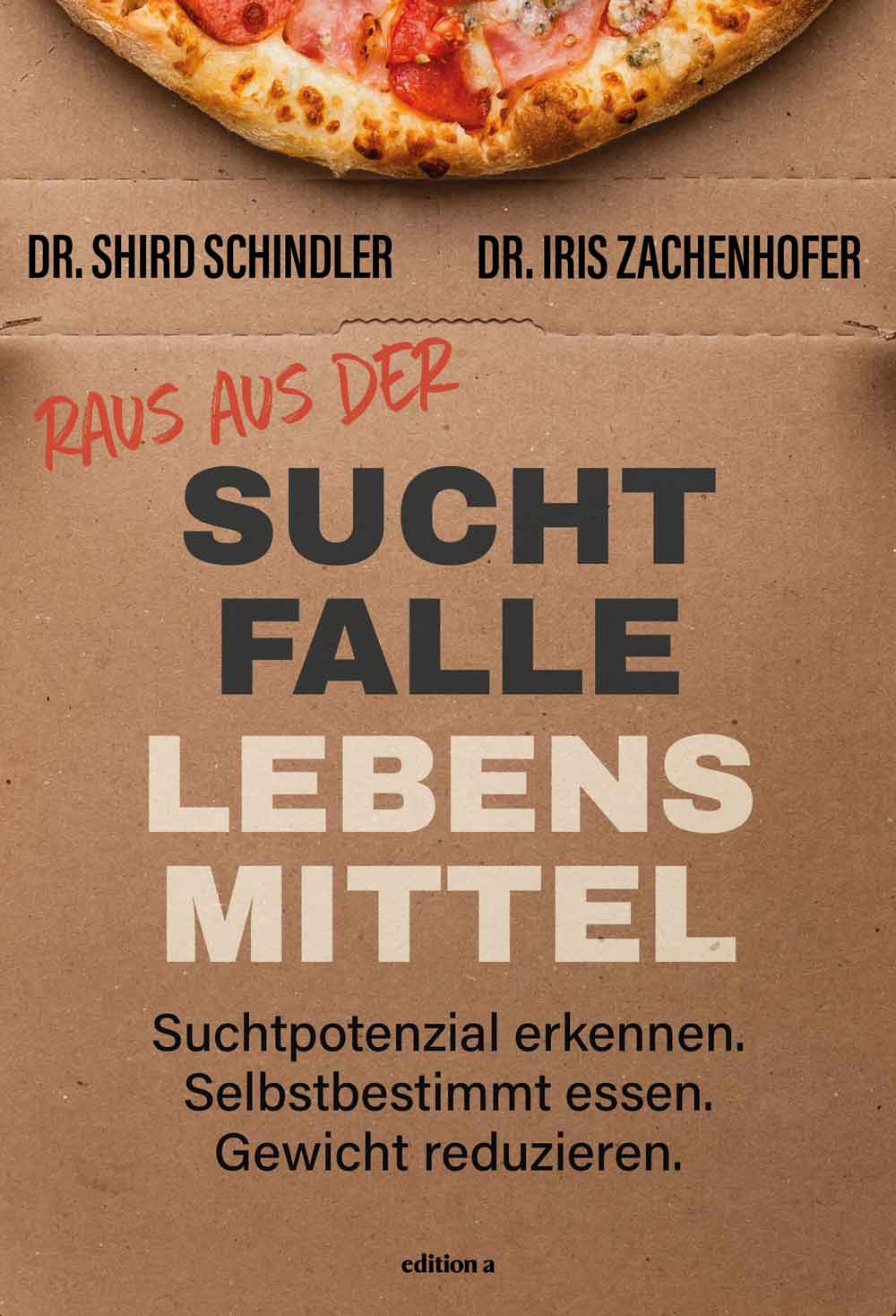


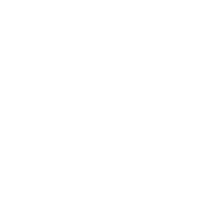
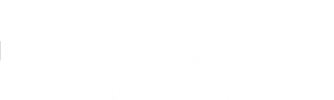










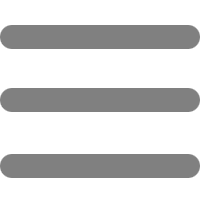

 Gütsel RSS Feed
Gütsel RSS Feed